Lisa Graf: Lindt & Sprüngli. Zwei Rivalen, ein Traum. Roman (Band 2 der Lindt & Sprüngli-Saga), München 2025, Penguin Verlag, ISBN 978-3-328-60417-4, Klappenbroschur, 476 Seiten, Format: 13,7 x 4,2 x 20,6 cm, Buch: EUR 17,00, Kindle: EUR 14,99, auch als Hörbuch lieferbar.
Sprüngli aus Zürich ist schon gut im Geschäft
Zürich im 19. Jahrhundert: Wie die Züricher Konditorenfamilie Sprüngli ins Schokoladengeschäft eingestiegen ist, haben wir im ersten Band der Reihe erfahren (Lisa Graf: LINDT & SPRÜNGLI. ZWEI FAMILIEN, EINE LEIDENSCHAFT). Bei den -Sprünglis ist inzwischen schon die zweite Generation im Geschäft. Johann Rudolf (geb. 1847) und sein Bruder David Robert (geb. 1851) – auch wenn immer noch der Vater, Firmengründer Rudolf Sprüngli, (geb. 1816) das Sagen hat.
Der Laden brummt, die Firma verlagert und vergrößert ihre Produktionsstätte, die Sprüngli-Söhne gründen Familien. Wobei sich der jüngere Bruder, David Robert, in allem etwas schwertut. Der schüchterne junge Mann wäre am liebsten Konditor geworden, aber das Familienunternehmen presst ihn ausgerechnet in die Rolle des Reisenden. Obwohl ihm das gar nicht liegt, muss er im Außendienst potentielle Kunden von den Vorzügen der Sprüngli-Schokolade überzeugen. Doch auch, wenn ihn der Job gegen den Strich bürstet: Es ist daran nicht alles schlecht …
Rudolf Lindt: als Lehrling nach Lausanne
Bern in den 1870er-Jahren: Die künftigen Mitbewerber aus Bern sind zu der Zeit noch nicht im Spiel. Der Apothekersohn Rudolf Lindt (geb. 1855) ist Anfang der 1870er Jahre noch ein planloser und wenig ambitionierter Schüler.
Meist träumt er vor sich hin statt zu lernen, hilft ohne große Begeisterung in der elterlichen Apotheke mit oder treibt sich mit seiner jüngeren Schwester Fanny und Binia Haab, einer Freundin aus Kindertagen, in der Gegend herum. Eines weiß er gewiss: Apotheker, wie sein Vater, will er auf gar keinen Fall werden! Eine Alternative hat er aber nicht. Er lässt einfach alles auf sich zukommen.
Nach einem tragischen Todesfall steht Rudolf Lindt dermaßen neben sich, dass ihm sein Großonkel Charles-Amédée Kohler noch auf der Beerdigung anbietet, ihn mit nach Lausanne zu nehmen. Wenn ihm hier in Bern alles zu viel ist und er ohnehin nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, könnte er ja in der Schokoladenfabrik der Kohlers eine Ausbildung machen. Rudolf ist alles egal. Dann geht er eben mit nach Lausanne.
Seine Großcousins Charles und Adolphe Kohler, die die Fabrik leiten, lassen den verwöhnten „Kleinen“ zunächst als unbezahlten Arbeiter schuften wie ein Tier. Doch wie sehr sie – vor allem Charles – ihn auch schinden und schikanieren, der Bursche aus Bern gibt nicht klein bei. Er will’s ihnen allen zeigen! Und er will jetzt unbedingt lernen, wie man Schokolade macht.
Aus Rudolf wird Rodolphe
Dass Rudolf sich in der französischsprachigen Schweiz nun „Rodolphe“ nennt, hilft dem Leser enorm bei der Orientierung. Sowohl auf der Lindt- als auch auf der Sprüngli-Seite gibt’s nämlich mehrere Rudolfs, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Mehr als einmal habe ich im Personenverzeichnis (Seite 471/472) nachgesehen, von wem, beziehungsweise von wessen Eltern, Ehefrau oder Kindern jetzt gerade die Rede ist.
So etwas passiert eben, wenn man einen Roman schreibt, der auf realen Personen und Ereignissen beruht: Die Leute heißen wie sie heißen, und die Autorin kann nicht viel dagegen tun.
1879: Holpriger Neustart in Bern
Auch wenn der cholerische Großcousin Charles vor keiner Gemeinheit zurückschreckt: Rodolphe bleibt mehrere Jahre bei der Firma Kohler, zuletzt als Mitarbeiter im Außendienst. 1879 kehrt er nach Bern zurück. Zu seiner Herkunftsfamilie zieht es ihn eigentlich nicht. Die sieht auf ihn herab, weil er die Schule abgebrochen hat und unter die Fabrikanten gegangen ist. Kein Akademiker – keine Anerkennung!
Auch seine langjährige Freundschaft mit der Krämerstochter Binia Haab ist seiner Familie ein Dorn im Auge. Sie ist deutlich unter seinem Stand. Dabei sind die beiden nicht einmal ein Paar, sondern nur Freunde. Vielleicht greift hier der Westermarck-Effekt, weil Rodolphe und Binia sich seit früher Kindheit kennen. Man weiß es nicht.
Mit Binia ist er jedenfalls während seiner Lausanne-Jahre in Kontakt geblieben. Und jetzt hilft sie ihm, ein Gebäude für seine eigene Schokoladenfabrik zu finden – und einen kompetenten Mechaniker. Mehr als eine halbverfallene Mühle und Maschinen aus zweiter oder dritter Hand kann Rodolphe sich jedoch nicht leisten.
Rodolphe tüftelt – und verzweifelt
Auch wenn er ganz genau weiß, wie das mit der Schokoladenherstellung geht, kriegt er es mit seinem zusammengeklaubten Equipment einfach nicht hin. Da kann sein Mechaniker Jakob „Köbi“ Steiner noch so kreativ und findig sein.
Langsam gehen dem Firmengründer Geld und Geduld aus.
Kann ein Studienkollege seines Vaters, der Chemiedozent Dr. Studer, weiterhelfen? Er dürfte wissen, wie die Bestandteile der Rezeptur miteinander reagieren und warum sie hier nicht mittun.
Unterstützung erfährt Rodolphe schließlich von unerwarteter Seite, und dann kommt ihm auch noch der Zufall zu Hilfe. Jetzt werden die etablierten Mitbewerber wie die Firma Sprüngli auf einmal hellhörig: Da ist ein Jungspund am Markt, der etwas kann und sich was traut …!
Die Geschichte erstreckt sich von 1863 bis 1880 und wird abwechselnd aus der Sicht von Rodolphe Lindt und den beiden Sprüngli-Brüdern erzählt. Auch Freunde und Angehörige kommen in einzelnen Kapiteln zu Wort. Man muss sich schon ein wenig konzentrieren, um den Überblick zu behalten, vor allem wegen vielen Rudolfs. Ich habe das Buch mit nur wenigen Unterbrechungen gelesen. Das hilft, genau wie das Personenverzeichnis.
Kampf mit Rezeptur und Technik
Mich interessieren Firmengeschichten, weil es mich fasziniert, wie aus einer kleinen Idee ein großes Unternehmen wird, das Generationen überdauert. Ich will auch bei allem Möglichen wissen, wie es produziert wird und funktioniert und liebe entsprechende Fernseh-Dokus. Wie Rodolphe und seine Getreuen mit Rezeptur und Technik kämpfen, um die Schokolade so hinzukriegen, wie sie ihnen vorschwebt, war für mich so spannend wie ein Krimi.
Ich glaube, mit dem eigenbrötlerischen Rodolphe Lindt werden seine Unterstützer und Konkurrenten noch einiges erleben!
Er denkt nicht wie ein Fabrikant, und so ist ihm mit den üblichen Mitteln vermutlich nicht beizukommen. Er sieht ein Problem und will es lösen. Was danach kommt, ist ihm nicht mehr so wichtig.
Und wie geht die Geschichte weiter?
Ich bin schon gespannt auf den dritten Band und hoffe auf ein Wiedersehen mit meiner Lieblings-Nebenfigur, dem schmuddeligen, mundfaulen und grenzgenialen Mechaniker Köbi. Und ich wüsste gern, was aus Rodolphes kleinem Bruder, dem „Satansbraten“ August, wird. Der ist mir ungefähr so „sympathisch“ wie Joffrey Baratheon aus GAME OF THRONES. Und die solchen bessern sich in der Regel nicht. Na, wir werden ja sehen …
Die Autorin
Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Sie hat nicht viele Schwächen, aber zu Lindt-Schokolade konnte sie noch nie nein sagen. Mit ihren Familiensagas Dallmayr sowie Lindt & Sprüngli schaffte sie es bis an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste.
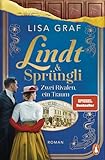 |
ASIN/ISBN: 3328604170 |

