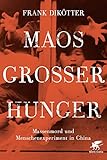Klappentext:
Der neue Roman Julian Barnes' über eine platonische Liebe und
den Tod einer besonderen Frau, der zum Anlass für die tiefere
Auseinandersetzung eines Mannes mit Liebe, Freundschaft und Biografie wird.
Neil, gescheiterter Schauspieler, Vater und Ehemann, besucht an
der Abenduni eine Vorlesung zur Kultur und Zivilisation und ist fasziniert von
der stoischen und anspruchsvollen Professorin Elizabeth Finch. Er hat zwar
Affären und Liebeleien, doch prägt das Ringen um ihre Anerkennung sein Leben.
Auch nach Beendigung des Studiums bleiben die beiden in Kontakt. Als sie
stirbt, erbt Neil ihre Bibliothek und Aufzeichnungen - und stürzt sich in ein
Studium Julian Apostatas, der für Elizabeth Finch ein Schlüssel zur Bedeutung
von Geschichte an sich war: Der römische Kaiser wollte im 4. Jahrhundert das
Christentum rückgängig machen. Wer war Julian Apostata? Und was wäre passiert,
wenn er nicht so jung gestorben wäre? Der Schlüssel zur Gegenwart liegt nicht
selten in der Verhangenheit, das zeigt dieser kenntnisreiche Roman auf
unnachahmliche Weise.
Das Buch ist eine intelligente Hommage an die Philosophie, ein
Ausflug in die Geschichte, eine Einladung, selbst zu denken.
Mein Lese-Eindruck:
Der Ich-Erzähler Neil
besucht im Abendkurs ein historisches Seminar. Neil ist kein strahlender Held.
Er ist als Schauspieler gescheitert, seine beiden Ehen gingen in die Brüche,
und seine Kinder bezeichnen ihn mit gutem Grund als „König der unvollendeten
Projekte“. Aber die Kursleiterin Elizabeth Finch ist für ihn die ideale
Lehrerin. Ihre Methoden und vor allem ihr Wesen fangen Neil ein. EF, wie sie
bald genannt wird, ist völlig uneitel, spricht immer frei mit ruhiger und
klarer Stimme, hat ihren Vortrag ausgearbeitet im Kopf und strahlt eine
Autorität aus, der sich die Studenten nicht entziehen können. Ihre Methode ist
die Mäeutik, in bester sokratischer Tradition: sie konfrontiert ihre Studenten
mit einem Zitat, z. B. des Stoikers Epiktet, und regt zum Selber-Denken an. „Es
ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zu helfen. ... Ich bin hier, um Ihnen zur Seite
zu stehen, wenn Sie sich im Denken und Argumentieren üben und eine eigene
Meinung entwickeln.“ (Pos. 185). Sapere aude! Neil ist fasziniert von dieser
intelligenten und souveränen Frau und bleibt ihr ihr Leben lang und auch nach
ihrem Tod verbunden. Die Frage treibt ihn um, wer Elizabeth Finch denn nun
eigentlich gewesen sei.
Nach ihrem Tod erbt er
ihre Unterlagen und versucht hier, Persönliches zu finden – vergeblich. Stattdessen
findet er jede Menge Sentenzen und Aphorismen, aber auch Notizen zu einer
historischen Gestalt und zu einem Wendepunkt der Geschichte, zu dem EF
offensichtlich eine Veröffentlichung plante. Neil beschließt, EFs Arbeit fortzusetzen
und den Essay zu schreiben, den sie nicht mehr schreiben konnte. Es geht um den
spätrömischen Kaiser Flavius Claudius Julianus des 4. Jahrhunderts n. Chr., den
letzten der Claudischen Kaiser, dessen Onkel Konstantin der Große das
Christentum neben den bisherigen paganen Religionen zugelassen hatte
(Konstantinische Wende). Julian versuchte vergeblich, die Bedeutung des
Christentums, das er als Religion des Leidens sah, zurückzudrängen und den
fröhlicheren und weltzugewandteren paganen Religionen wieder Bedeutung zukommen
zu lassen. Weshalb ihn dann die christlich orientierte Geschichtsschreibung des
Mittelalters als „Apostata“, als Ketzer, verunglimpfte, und als Julian Apostata
ging er auch in die Geschichte ein.
Barnes lässt seinen
Protagonisten der faszinierenden Lebensgeschichte dieses letzten heidnischen
Kaisers nachspüren, und der Leser erfährt von Julians Liebe zur Philosophie,
seiner religiösen Toleranz, seinen unmäßigen Opferschlachtungen, seinen Feldzügen etc. und seiner
Auffassung, dass Menschen mit Vernunft und nicht mit Gewalt zu überzeugen
seien. Die Todessehnsucht der Christen lehnt er ab, das ist nicht seins,
schnell das irdische Jammertal zu verlassen, um in die ewigen Freuden des
Himmels zu gelangen! Daher schiebt er dem Märtyrer-Tod einen Riegel vor: niemand
wird wegen seiner Religion hingerichtet, sondern er nötigt die Christen, den
„langsamen, verschlungenen steinigen Pfad des irdischen Lebens zu gehen“ (Pos.
1258). Eine interessante Biografie!
Neil nimmt auch die
Wirkungsgeschichte des Julian Apostata in den Blick, ausgehend von dem Gedicht
Swinburnes „Hymne an Proserpina“, in dem der tödlich verletzte Kaiser seine
Niederlage gegenüber dem Christentum eingesteht: Du hast gesiegt, o bleicher Galiläer; die Welt ist grau geworden von deinem Atem. Montaigne,
Voltaire, Milton, Ibsen, James Joyce, sogar Hitler, der zeitgenössische Autor
Butor u. a. befassen sich mit diesem Kaiser und diesem historischen Wendepunkt.
Der Leser wird nun, so
wie EF es getan hätte, auch zum Nachdenken angeregt: Was wäre gewesen, wenn
nicht der „bleiche Galiläer, sondern das „Heidentum“ gesiegt hätte? Führt ein
Weg von diesem Wendepunkt „zu der Gefühlskälte und dem päpstlichen
Autoritarismus des christlichen Europa – zum freudlosen schuldbeladenen
Protestantismus wie zum korrupten schuldbeladenen Katholizismus“ (Pos. 2278)?
Das Buch ist ein
anregender Ausflug in die Philosophie, in die Geschichte und ihre möglichen
Alternativen, auch in die Fragen des Umgangs mit unsicheren historischen
Fakten. Das Lesen wird zum Vergnügen durch die Ironie und die Respektlosigkeit,
mit der Barnes auch „heilige“ Stoffe wie den Märtyrertod betrachtet.
Barnes hat, wie
gewohnt, hervorragend recherchiert. Allerdings leiden darunter seine Personen,
die man sich gerne lebendiger gewünscht hätte.