Großartig!
Im Jahr 1903 hat Rainer Maria Rilke das Gedicht „Der Panther“ verfasst, aus dem die Zeile stammt, die dem in jeder Hinsicht ganz erstaunlichen Romandebüt von Ulrike Sabine Maier den Titel gegeben hat – ein Roman, dessen Handlung knapp 20 Jahre nach dem Entstehen dieses berühmten Gedichts beginnt und bis ins Jahr 2016 führt, also fast hundert Jahre umspannt. Er erzählt von Inge und ihrer Tochter Luise, von zwei Frauen, deren gemeinsame Geschichte in der schwersten, bittersten, dunkelsten Zeit des vergangenen Jahrhunderts begann.
Die Fabrikantentochter Inge ist sehr gescheit und ziemlich attraktiv – in den Dreißigerjahren wird man ihr große Ähnlichkeit zur Filmemacherin Leni Rieffenstahl attestieren, die umstritten war und ist, weil sie sich für die Nazi-Propaganda instrumentalisieren ließ. In einer ganz ähnlichen Situation befand sich die berühmte Pianistin Elly Ney, der Maiers Romanfigur Inge begegnet und zu der und deren Tochter sie ein besonderes Verhältnis entwickelt, obwohl Inge nonkonformistisch und rebellisch ist, obwohl sie, wie sie sich selbst immer wieder sagt, „ein Tier in sich trägt“ (möglicherweise einen Panther), obwohl sie später zur Peripherie der Weißen Rose gehören und nur mit Glück dem Schicksal von Hans und Sophie Scholl entgehen wird.
Aber von vorne. Dieser sehr originell aufgebaute und in einem ganz besonderen Duktus verfasste Roman springt von vorne in die Mitte und nach hinten und arbeitet sich dann wieder langsam vor. Im Mittelpunkt steht zuerst Inge, die für sich früh beschließt, Medizinerin zu werden, eigentlich ein Unding zu jener Zeit und für eine Frau aus ihren Verhältnissen, und die dann auch noch außerehelich schwanger wird, von einem Mann, der sich nur kurz in ihrem Leben aufhält, weshalb Inge, als sich die Machtübernahme der Nazis abzeichnet, den Antrag von Kurt annimmt, seinerseits Sohn eines wohlhabenden Unternehmers, während Inge bei den eigenen Eltern längst in Ungnade gefallen ist. Luise, die von den angeheirateten Großeltern in Inges Abwesenheit „Bastard“ genannt wird, überfordert die junge, umtriebige, rast- und atemlose, angehende Medizinerin, die das Kind erst ins Kinderheim und nach Kriegsbeginn zu diesen Großeltern gibt, wo Luise zwar satt wird, aber sonst absolut nichts hat. Die Ehe zerbricht, und dann zerbricht die ganze Welt.
„Hinter tausend Stäben“ ist jedoch kein historischer Roman, obwohl das unfassbare Drama der Nazizeit mehr als nur eine äußerst anschaulich wiedergegebene Kulisse darstellt – Ulrike Sabine Maier lässt einen tief in die Atmosphäre der Zeit eintauchen, das Grauen, den Hunger, die Angst und die Ohnmacht direkt mitfühlen. Doch das Buch ist ein Figurenroman, ein Heldinnenroman. Allerdings sind es tragische Heldinnen – Frauen, denen die Welt und die Menschen auf dieser Welt nicht geben wollen oder können, was nötig wäre, die gefangen sind und nicht dürfen, was sie möchten. Die ruhelose, getriebene, kunstverliebte Inge, die vermutlich unter einer psychischen (bipolaren?) Störung leidet, und die kluge, stille, beobachtende, starke Luise, für die Inge keine Mutter zu sein vermag, und die in ihrer schweren Kindheit nur wenige Momente des Glücks erleben darf.
Es ist aber vor allem ein Sprachroman, ein Buch, das von dieser furiosen Ausdrucksstärke getragen wird, davon, sowohl für die eingeschüchterte kleine Luise, als auch für die jederzeit vibrierende Inge die richtige Tonalität zu finden, sprachliche Bilder und Satzkompositionen, die verblüffen und überraschen und wie die Faust aufs Auge passen. Großartig.
Nur die Figurenschar wird gelegentlich etwas unübersichtlich, und manch ein Dialogsatz wäre besser ohne Ausrufezeichen am Ende ausgekommen, aber das ist Nörgeln auf so hohem Niveau, dass es nicht zählt.
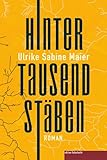 |
ASIN/ISBN: 3689350131 |

