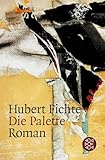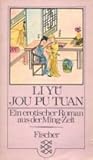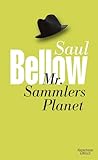Teil II der Rezension
Die Architektur des Figurentableaus ist seltsam. Seine Konstruktion scheint weniger tragendes Element des Romans als äußerer Ausdruck unterdrückter Bestrebungen des Autors zu sein. Aufschlussreich ist bereits die Rolle von Frauen im Roman. Die Gattinnen der britischen Beamten sind durchweg intoleranter und gehässiger als ihre Männer. In dieser Darstellung muss man noch kein Anzeichen von Misogynie beim Autor sehen – die Männer haben als Amtspersonen mehr Objektivität walten zu lassen und mehr Rücksicht zu nehmen als ihre Hausfrauen. Tatsächlich ist Mrs. Moore die einzige überwiegend positiv dargestellte weibliche Person, eine zur Verehrung geeignete Mutterfigur. Doch auch sie nimmt im Text wenig Raum ein, so wenig wie das Verhältnis zwischen den zeitweise miteinander Verlobten.
Im Zentrum des Romans steht die Beziehung Aziz - Fielding. Der junge Arzt idealisiert seine früh verstorbene Gattin: „Und nun erst begriff er, was er an ihr verloren hatte, begriff, dass keine Frau jemals wieder an ihre Stelle treten könnte, in gewissem Sinne vielleicht nur noch ein männlicher Freund.“ Diesen scheint er in Fielding zu erkennen. Die beiden sind sich auf Anhieb ungewöhnlich sympathisch. Aziz, mit anderen eingeladen, kommt zu früh, als Fielding noch nicht fertig angekleidet ist. Sie treffen erstmals aufeinander und unterhalten sich von Raum zu Raum, ohne sich schon zu sehen. Es kommt auch hier jetzt zu einem Missgeschick, das eine engere Verbindung herstellt. (Die Wiederholung eines Motivs ist generell ein häufiges Stilmittel bei Forster.) Fielding ist der Knopf für das hintere Kragenloch heruntergefallen. Aziz dringt ins Schlafzimmer ein und ist mit einem rasch vom eigenen Hemd genommenen Knopf behilflich: „Lassen Sie mich den Knopf befestigen. Ach so … Das hintere Knopfloch ist etwas klein, und es wäre doch schade, es weiter aufzureißen … Hurra, der Kragenknopf ist drin!“
Geht man zu weit, in dieser Szene eine Anspielung auf Erotisches, Sexuelles zu sehen? In der Verfilmung durch David Lean wird sie entschärft, indem Fielding das Schlafzimmer verlässt, dann erst Aziz’ Knopf entgegennimmt und selbst am Kragen befestigt! Im Roman erleben wir einige Seiten davor Aziz zu Pferd auf dem Maidan, wie er die flüchtige Bekanntschaft eines anderen jungen Berittenen macht. Es ist sogleich von einer „gewissen Zuneigung“ die Rede, die bei beider Polo-Training zur „hellen Wärme der Brüderlichkeit“ wird. Forster scheint an einer weiteren Stelle Aziz’ latente Bisexualität anzudeuten. Er begegnet Nureddin, Enkel eines muslimischen Großgrundbesitzers, „einem etwas weibischen Halbwüchsigen, mit dem er sonst nur selten zusammenkam, der ihm stets aber von neuem gefiel und den er unfehlbar dann gleich wieder vergaß …“ Nureddin hat noch weitere Auftritte im Roman und wird diskret als homosexuell charakterisiert.
Was Aziz und Fielding betrifft, so relativiert Forster im weiteren Verlauf den speziellen Subtext, indem er den jungen Arzt an ein Treffen mit einer Prostituierten in Kalkutta bloß denken lässt – und Fielding heiratet später in England Stella, eine Halbschwester von Heaslop. Mit seiner Gattin und Ralph, ihrem jüngeren Bruder, kehrt Fielding nach Indien zurück und begegnet auf einer Dienstreise Aziz noch einmal. Aziz lernt Ralph, der Schwager und Schwester begleitet, kennen, es wird wieder eine den Arzt unmittelbar sehr bewegende Bekanntschaft. Dagegen wird Stella dem Leser wie auch Aziz auf fast schon rüde Weise vorgestellt: Sie wird beim Zusammenstoß und Kentern zweier Boote gegen Aziz geschleudert, dann weiter nichts. Weniges über sie entnimmt man noch auf den letzten Seiten des Romans einem Gespräch zwischen Aziz und Fielding. Die beiden Männer versöhnen sich und sind sich einig darin, dass zwischen ihnen – als einem Inder und einem Engländer – in dieser Zeit und in diesem Land praktizierte Freundschaft nicht möglich ist. Und der Leser fragt sich: Worum geht es hier auch noch? Signalisiert uns der Autor etwa, dass er gern einen anderen Stoff oder diesen hier lieber auf andere Weise gestalten würde?
In Forsters Indienroman repräsentiert allein ein einzelner Gerichtsdiener die Welt des physisch Begehrenswerten. Es ist der punkah-Mann, der mit seiner Körperkraft während der Verhandlung einen mechanischen Ventilator bedient. Der Erzähler schwelgt eine ganze Seite lang in seiner Darstellung: „Fast unbekleidet und körperlich prachtvoll gebaut … besaß jene Kraft und Schönheit … Natur der körperlichen Vollkommenheit … musste er geradezu als gottgleich erscheinen … eine männliche Schicksalsgöttin … Vorort-Jehova …“ Der so hymnisch Gefeierte hat außer der Betätigung seiner Muskelkraft keinerlei Bezug zur Romanhandlung und deren Trägern, er ahnt nicht einmal, was um ihn herum vorgeht. David Lean setzt die Figur in seinem Film ebenfalls in einer winzigen Einstellung ein, obwohl es dramaturgisch überflüssig ist, und bei ihm ist aus dem Adonis ein unattraktiver alter Mann geworden, halb bekleidet. Der Filmemacher, von dem auch das Drehbuch ist, scheint hier, wie schon in der Ankleideszene, das Bedürfnis verspürt zu haben, sich von Unterschwelligem bei Forster zu distanzieren.
Forster schrieb im gleichen Lebensabschnitt den Coming-out-Roman „Maurice“ und bestimmte, dass er erst posthum veröffentlicht werden durfte, ebenso wie die Reihe von Erzählungen verwandten Inhalts, die er im Anschluss an den Indienroman noch schuf (nach seinem Tod im Sammelband „The Life to Come“ erschienen). „A Passage to India“ blieb Forsters letzter veröffentlichter Roman, obwohl sein Leben noch weitere sechsundvierzig Jahre währte. Im Rückblick konstatierte er einmal: „I should have been a more famous writer if I had written or rather published more, but sex has prevented the latter.“
(Romanzitate nach der Übersetzung von Wolfgang von Einsiedel)
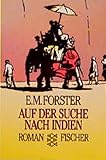 |
ASIN/ISBN: 359625308X |