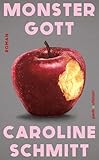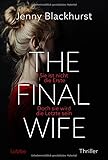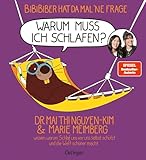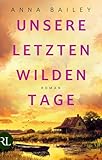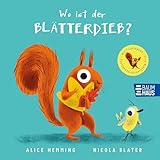Frankreich im Jahr 2023: Mia Daoud, eine bekannte Schriftstellerin, hat nach einer Covid-Infektion mit „Brain Fog“ zu kämpfen. Sie kann sich nicht mehr richtig konzentrieren und hat keinen Zugriff auf ihre Erinnerungen. Nach dem entsprechenden Tipp eines Arztes reist sie nach Marokko. Dort ist sie aufgewachsen. Doch als junge Frau hat sie ihre frühere Heimat verlassen. Als sie nun auf der Farm ihrer Großeltern in Meknès ankommt, fühlt sie sich allerdings fremd…
„Trag das Feuer weiter“ ist der dritte Teil der „Das Land der Anderen“-Trilogie von Leïla Slimani.
Der Roman gliedert sich in zwei Teile, die von einem Pro- und einem Epilog eingerahmt und durch ein „Intermezzo“ getrennt werden. Die Handlung umspannt mehrere Jahrzehnte, beginnend 1980, und spielt in Frankreich und Marokko.
Erzählt wird aus wechselnder Perspektive aus der Sicht verschiedener Personen. Die Sprache ist eindrücklich, atmosphärisch und pointiert, dabei zugleich wunderbar unprätentiös und dennoch mit einer leicht poetischen Note.
Bei der Geschichte handelt es sich um den Abschluss einer französisch-marokkanischen Familiensaga, inspiriert von den Biografien der Großmutter und Mutter der Autorin. Der neue Roman schließt an „Das Land der Anderen“ und „Schaut, wie wir tanzen“ an. Es empfiehlt sich, die Trilogie in der korrekten Reihenfolge zu folgen. Dank eines Personenverzeichnisses mit Zusammenfassungen lässt sich der dritte Teil jedoch auch ohne Vorkenntnisse verstehen.
Diesmal begleiten wir mit Mia, Mathildes Enkeltochter, hauptsächlich die dritte Generation der Familie. Mir hat es gefallen, dass eine queere Protagonistin im Vordergrund steht. Ihre Gedanken und Gefühle konnte ich gut nachvollziehen. Sie und die übrigen Hauptfiguren wirken authentisch und werden mit psychologischer Tiefe dargestellt.
Auf der inhaltlichen Ebene dreht es sich vor allem um das Heranwachsen, die Suche nach Freiheit und der eigenen Identität. Welchen Einfluss haben unsere Erinnerungen und unsere familiären Wurzeln auf unser Sein? Welche Rolle spielt unsere Geschichte? Auch diesen Fragen geht der Roman nach.
Auf den rund 450 Seiten bietet der Roman nicht nur eine glaubwürdige Handlung, sondern liefert auch Hintergrundwissen zu den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in den vergangenen Jahrzehnten in Marokko. Darüber hinaus überzeugt die Geschichte immer wieder mit bewegenden Momenten.
Die deutsche Ausgabe bleibt optisch wieder nah am französischen Original. Das Foto des Covermotivs wurde übernommen. Zudem wurde der Titel fast wortgetreu übersetzt („J‘emporterai le feu“).
Mein Fazit:
Mit „Trag das Feuer weiter“ gelingt Leïla Slimani ein würdiger und überzeugender Abschluss ihrer Familientrilogie. Eine Lektüre, die Unterhaltung und Anspruch auf gekonnte Weise verbindet.
Ich vergebe 5 von 5 Sternen.