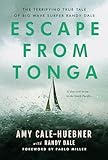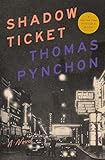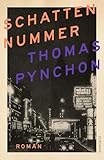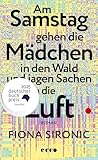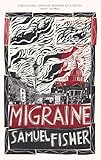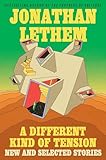Heute 22.30 deutscher Zeit wird der Preis vergeben.
Ich habe die Shortlist gelesen und insgesamt 9 Titel der Longlist, und mein persönliches Ranking sieht so aus:
1. Katie Kitamura - Audition (5 von 5 Sternen)
Ein sehr dichtes und kühles Experiment über das Performative im Leben, ohne eindeutige Auflösung und Interpretation. Wird Leser, die eine geradlinige Geschichte wollen, frustrieren, mich hat der verspielte, experimentelle Ansatz aber begeistert.
2. Kiran Desai - The Loneliness of Sonia and Sunny (5/5)
Fast 700 Seiten. Die Geschichte über zwei Inder, teilweise in den USA. Eine Art literarischer Liebesroman mit einem internationalen, geopolitischen Hintergrund, den ich spannend und zeitgemäß fand. Teilweise durch die Länge aber auch geradezu ausufernd in der Detailfülle und den Nebenplots. Das komplette Gegenteil zur Dichte und Kühle von Audition.
Dann lange nichts, weil jetzt wird die Qualität eher gruselig.
3. David Szalay - Flesh (2.5/5)
Soll wohl ein Roman über moderne maskuline Toxizität sein und ist so umgesetzt, dass die Unfähigkeit der Hauptfigur, Emotionen auszudrücken, in einer Sprache widergespiegelt wird, die komplett ohne Beschreibung von Emotionen, Sensorik, Haptik und deskriptiven Details auskommt. So reduziert und runtergekühlt, dass es einerseits interessant, andererseits wiederum frustrierend zu lesen ist. Zudem scheint mir die Idee dieses Experiments doch recht banal umzusetzen zu sein, und ich werde das Gefühl nicht los, Juroren und Kritiker werden hier mit relativ wenig Aufwand verarscht, indem man ihnen diesen pseudo-literarischen Happen hinwirft. Trotzdem für den Versuch und die Chuzpe noch mein dritter Platz.
4. Susan Choi - Flashlight (2.5/5)
Das erste Kapitel hat mir gefallen, das auch so vor ein paar Jahren im New Yorker als Kurzgeschichte abgedruckt wurde. Die sprachliche Qualität nimmt dann doch über den Rest dieser koreanisch-japanisch-amerikanischen Mehrgenerationensaga deutlich ab, als hätten da die New Yorker-Lektoren gefehlt. Ist mir insgesamt viel zu konventionell erzählt. Der politische Hintergrund mag interessant sein. Wen ein Familienmysterium mit einem nordkoreanischen Setting interessiert und es nicht zu literarisch ausgearbeitet braucht, mag hier auf seine Kosten kommen.
5. Andrew Miller - The Land in Winter (2/5)
Langweilig. Sehr gewöhnliche Geschichte im England der 60er Jahre, wo es um die Beziehung zweier Paare geht, sonst eigentlich nichts. Sehr minutiöse Sprache (die literarisch besten zwei Seiten über die Zubereitung von Rührei, die ich je gelesen habe). Die angedeuteten Post-Weltkriegs-Traumata fand ich nicht ausgearbeitet, einfach nur da für so etwas wie minimal anspruchsvollen Hintergrund.
6. Ben Markovits - The Rest of Our Lives (2/5)
Midlife-Crisis als Roadtrip. Der Roman enthält nichts, was man nicht schon in x Filmen oder Büchern gesehen hat. Keine Originalität, kein Subtext, keine Sprache.
Von den anderen drei Büchern, die es nicht auf die Shortlist schafften, waren Endling und Seascraper (Der Krabbenfischer) exzellent und hätten bei mir mit Audition um Platz 1 konkurriert.
Mein Tipp für den Sieger wäre Flesh, aber außer The Rest of Our Lives könnte es eigentlich jeder Titel schaffen.
One Boat war indiskutabel.